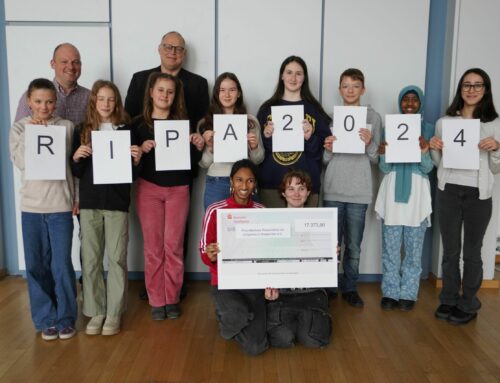Eilmeldungen, Artikel, Nachrichten oder Mundpropaganda. Irgendwie hat es jeden erreicht. Die verstörenden und erschreckenden Bilder über die politische Situation in Afghanistan. Die deutsche Beteiligung an dem Ganzen. Und dann: Das Abziehen der Truppen nach 20 Jahren. Doch was steckt überhaupt dahinter und was ist dort genau passiert?
Am 21. Januar 2022 hatten die Reli- beziehungsweise Ethikkurse der Einführungsphase der Albert-Schweitzer-Schule die Möglichkeit, einem Vortrag von Hauptmann Jens Bockwinkel, einem Jugendoffizier der Bundeswehr, beizuwohnen. Der 31-jährige war fünf Monate seiner Karriere in Kabul, der Hauptstadt des Krisengebietes, als Feldjäger stationiert. Als Feldjäger – so seiner Aussage zufolge – sei er quasi ein Polizist innerhalb des Militärs und kläre Vergehen und ähnliches auf. Während seiner Zeit in Afghanistan konnte der gebürtige Darmstädter zahlreiche prägende Erfahrungen sammeln, die jedoch nur einen kleinen Teil der facettenreichen Präsentation ausmachten.
Begonnen mit dem Anschlag auf die Twin Towers im September 2001, ausgeführt von der Terrororganisation Al-Qaida, dem gebotenen Schutz, den die Taliban ihnen in Afghanistan gewährten und dem Bündnis der Amerikaner mit den Deutschen und mehreren anderen Staaten, führte er die Gruppe Stück für Stück an das Thema heran. Mit dem ursprünglichen Gedanken, den Terroranschlag nicht einfach so hinzunehmen, wurden vor rund 20 Jahren Truppen in Afghanistan stationiert. Man entschied sich dafür zu versuchen, die relevanten Strukturen des Staates zu stabilisieren beziehungsweise zu schaffen, um dessen Souveränität, also Eigenständigkeit, erreichen zu können. Die Alternative zu dieser Handhabung wäre es gewesen „reinzugehen, alles niederzuwalzen und wieder zu gehen“. Diese Entscheidung war eine, die er als entweder die „schlechte“ oder die „noch schlechtere“ darstellte. Das geringere Übel setzte sich also als Ziel, die sogenannten niederen Schichten der Bedürfnispyramide für die Bürger des Landes erfüllen zu können. Diese beinhalten die Nahrungssicherung, die allgemeine Sicherheit und unter anderem auch ein Zuhause. Der Unterschied, den wir in Europa erkennen müssen, ist, dass viele Afghanen nach dem Überleben streben, während wir versuchen, unsere Ideale zu verwirklichen, was als höchste Stufe gilt. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, war es notwendig, Maßnahmen zu ergreifen. Ob die Bundeswehr nun die richtige Wahl war oder nicht, sei dahingestellt, denn, so Bockwinkel, im Nachhinein könne man solche Entscheidungen immer kritisieren und als falsch darstellen. Diesen Einsatz der deutschen Bundeswehr verglich er mit dem Einsatz eines Schweizer Taschenmessers als Universalwerkzeug anstatt eines Werkzeugkoffers mit angemessenen verschiedenen Werkzeugen. Sie war nicht als Kriegstruppe dort im Einsatz, sondern vielmehr als eine Kombination aus Wohltätern, Sozialarbeitern und Helfern zum Errichten der landeseigenen Infrastruktur. Das eigentlich erwähnte Problem sei jedoch nicht diese Verwendung der Einsatzkräfte gewesen, sondern dass nach Abzug ein „Machtvakuum“ hinterlassen wurde, da keine außerstaatliche Kontrollmacht mehr im Land war. Dieses Machtvakuum war laut dem Jugendoffizier die optimale Gelegenheit für die Taliban, ihre Machtposition wiederzuerlangen.

Auch wenn die Frage offenbleibt, ob der Einsatz berechtigt war und der Tod von etlichen Zivilopfern und allein rund 50 deutschen Soldaten gerechtfertigt ist, konnte Bockwinkel seine eigene Meinung deutlich zum Ausdruck bringen. Er selbst sei zum Beispiel nie in die Lage gekommen, dazu gezwungen zu sein, ein Leben zu beenden. Im Zweifelsfall würde er jedoch seiner Pflicht als Soldat nachkommen, sein eigenes Leben beschützen und ebenso sein Vaterland zu verteidigen. Auch wenn dieser Aussage vielleicht nicht jeder zustimmt oder sie nicht nachvollziehen kann, hat sie dennoch dazu geholfen, eine andere Sichtweise auf diesen Aspekt des Konflikts zu bekommen.
Als primäres Fazit lässt sich zusammenfassen, dass die Veranstaltung geholfen hat, einen Überblick über das gesamte ziemlich komplizierte und nur in vereinfachter Form dargestellte Konstrukt zu bekommen. Keineswegs wurde der Einsatz als richtig oder falsch dargestellt, was am Ende jedem Zuhörer aus dem Auditorium selbst im darauffolgenden Dialog unter den Schülern überlassen war.
Überzeugend war insbesondere die sympathische Art des Referenten, der es geschafft hat, innerhalb von gerade einmal neunzig Minuten auf einer kollegialen und persönlichen Ebene ein politisches Streitthema weitestgehend neutral darzustellen. Außerdem hervorzuheben ist, dass er in keine Weise davor gescheut hat, etwas über sich, sein Leben, seine Freundin Kelly, seine Katzen Nacho und Nala oder die persönlichen Erfahrungen preiszugeben. Durch diese Offenheit hat er es geschafft, den Zuhörern auf einer Ebene zu begegnen, auf der beide Seiten unbefangen und unvoreingenommen miteinander kommunizieren konnten.
Zu guter Letzt wollen wir uns im Namen der beiwohnenden Kurse, sowie im Namen der Schulgemeinde, des Kollegiums und der Schulleitung für diesen Vortrag bedanken und würdigen, dass Sie die wertvolle Zeit ihres 31. Geburtstags dafür bereitstellten, die Zukunft unserer Demokratie, die Probleme und Konflikte unserer gegenwärtigen Gesellschaft darzustellen.
Nele Stegemann / Leonie Schäfer (E-Phase)